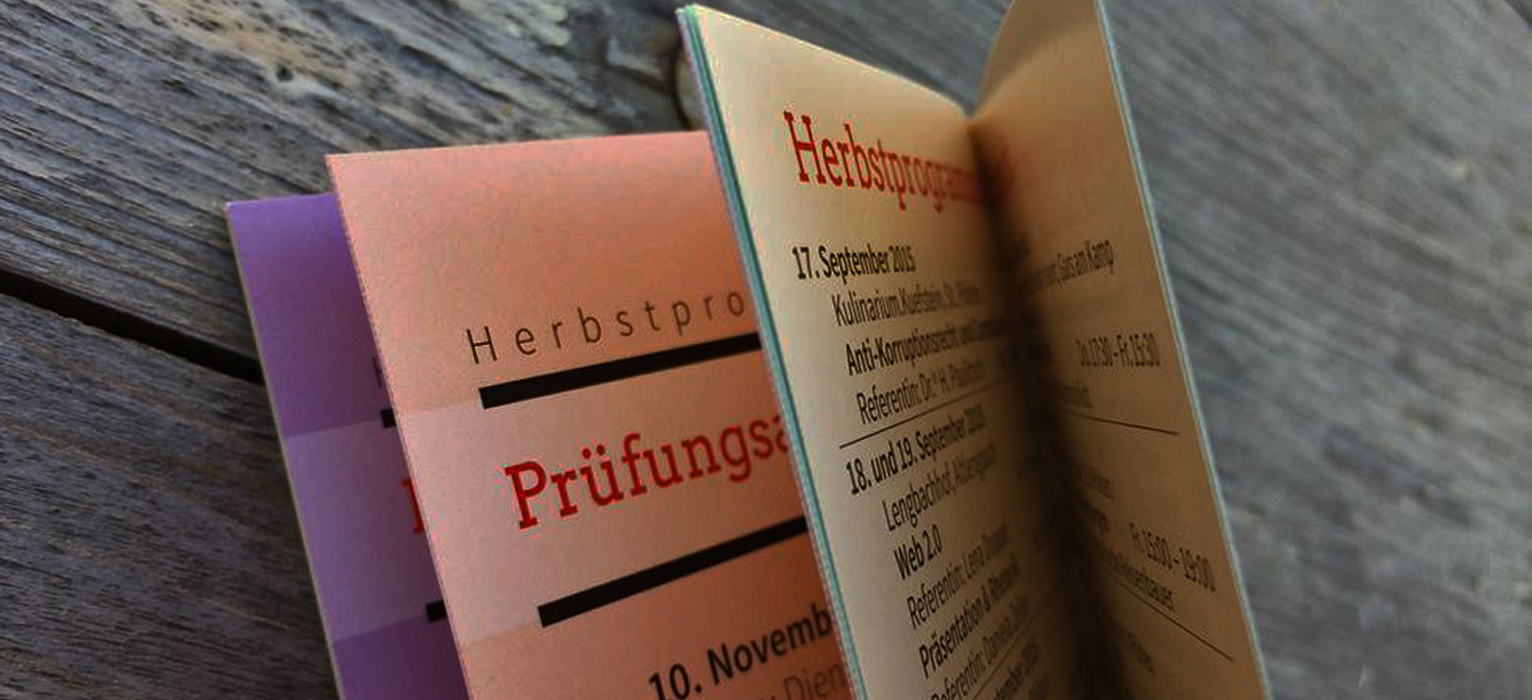Bezahlbare Wohnungen sind großes Thema für NiederösterreicherInnen.
Wo es keine Verkehrsanbindungen
gibt, gibt es keine Arbeit, keine Geschäfte, keine Kinderbetreuung, keine
Schule, keine Wirtshäuser. Fazit: Vor allem die jungen ziehen weg – nur wenige
gehen später wieder zurück nach Niederösterreich. Oft sind Versäumnisse der
Grund für die Ausdünnung in den ländlichen Regionen: ÖVP-InnenministerInnen
haben Polizeiposten geschlossen, auch in größeren Städten gibt es auf Bahnhöfen
keine Personenkassen mehr, Postämter und Nahversorger fehlen. Was
sozialdemokratische Politik an Lebensqualität bringen kann, zeigen –
beispielhaft für viele andere – vier NÖ Städte: Die Landeshauptstadt St. Pölten
mit Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, Schwechat mit Karin Baier, Krems mit
Dr. Reinhard Resch und Amstetten mit Ursula Puchebner.
Wohnen ist in
der Landeshauptstadt ein großes Thema: „Die Bevölkerung St. Pöltens wächst
stark und mit ihr auch die Nachfrage nach neuem Wohnraum. Es werden stets
Baugründe in den besten Lagen ausgesucht. Damit ist eine hohe Lebensqualität
garantiert“, erklärt Stadler, der darauf hinweist, dass er neben leistbaren Wohnungen
auch Baurechtsgründe in der anbietet, es gibt auch Sozialwohnungen. Auch bei
der Aktion „Junges Wohnen“ nimmt die Stadt eine Vorreiterrolle ein: „Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit, Wohnungen
anzubieten, die zum einen leistbar und zum anderen einen Start in die Eigenständigkeit
ermöglichen“, erklärt der Bürgermeister. Das Projekt „Junges Wohnen“ wurde in
Niederösterreich zum ersten Mal in der Landeshauptstadt St. Pölten von Matthias
Stadler initiiert.
Matthias Stadler, auch SPÖ Bezirksvorsitzender, umreißt
zwei Schwerpunkte für den Personennahverkehr: „Die Landeshauptstadt St. Pölten soll für
Niederösterreich sowohl zentraler Knoten, als auch Drehscheibe für den
öffentlichen Verkehr sein.“ Für Stadler ist es wichtig, dass der Zentralraum
aus allen Teilen des Flächenbundeslandes Niederösterreich zeitnah, modern und
kostengünstig erreichbar ist – aber auch die Verbindungen innerhalb von St.
Pölten und weiter nach Wien müssen ein gutes Angebot für die
NiederösterreicherInnen darstellen, damit diese vom Individual- auf den
öffentlichen Verkehr umsteigen. Für die Attraktivierung des öffentlichen
Personennahverkehrs nach St. Pölten braucht es die Schaffung eines abgestimmten
Taktfahrplans, die Verkürzung der Reisezeiten, die Erhöhung der
Geschwindigkeiten durch Infrastrukturmaßnahmen, den Einsatz moderner Fahrzeuge
und das weitgehende Vermeiden von Umsteigevorgängen. Stadler weist auf die
Forderung des 365-Euro-Tickets der SPÖ NÖ hin: „Um einen Euro täglich durch
ganz NÖ. Das ist ein wichtiger Beitrag für das Öffi-Angebot in
Niederösterreich, aber auch für den Klima- und Umweltschutz!“ Innerhalb von
St. Pölten ist das Bussystem LUP ein wichtiger Partner. „Deswegen ist es mir
nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Bezirksparteivorsitzender ein
Anliegen, dass sowohl die St. PöltnerInnen als auch die vielen Menschen, die
täglich von auswärts in die Landeshauptstadt kommen, ein gutes Angebot – zu
einem leistbaren Tarif – vorfinden.“
Anfang des Jahres wurde auch
das Gesundheitsangebot in St. Pölten mit dem Start eines
Primärversorgungszentrums erweitert. „Mit dieser neuen Primärversorgungeinheit
wird ein weiterer Meilenstein in der Gesundheitsversorgung gesetzt. St. Pölten
will „Fittest City of Austria“ werden und rückt in diesem Zusammenhang die
Gesundheitsvorsorge in den Mittelpunkt. Dieses neue Zentrum soll daher nicht
nur Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen sein, sondern ganz besonders
für die Prävention genutzt werden. Unser Ziel ist es, durch eine aktive
Gesundheitsvorsorge die Lebensqualität der Menschen bis ins hohe Alter zu
gewährleisten und dafür ist die neue Primärversorgungseinheit bestens geeignet.
Hervorzuheben sind die gute Lage mit ausreichend Parkplätzen und die
Erreichbarkeit mit dem LUP-Bussystem sowie die Barrierefreiheit. Als Bürgermeister
freut mich natürlich auch, dass hier viele moderne Arbeitsplätze für sehr
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden sind. Der
Gesundheitsstandort St. Pölten wird durch diese Einrichtung beträchtlich
aufgewertet“, sagt Stadler, der auch in anderen Stadtteilen derartige
Primärversorgungszentren forciert.
Schwechat setzt auf Lehrlinge
Auch in Schwechat gibt es ein
Primärversorgungszentrum, das, wie Bürgermeisterin Karin Baier sagt,
„unmittelbar nach dem Projekt in St. Pölten eröffnet wurde und ein wichtiger
Teil der Schwechater Gesundheitsversorgung ist“.
Ein zentraler Punkt des
„Zehn-Punkte-Pakets“ für die NiederösterreicherInnen, das von der SPÖ NÖ
präsentiert wurde, ist die Schaffung leistbaren Wohnraums und damit verbunden
die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten und die Einführung der
Widmungskategorie „Sozialer Wohnbau“. Und auch Schwechat stellt neben
Notwohnungen, die auf ein Jahr befristet bezogen werden können,
Starterwohnungen für junge Menschen zur Verfügung. „Vier Wohnungen sind derzeit
belegt, heuer kommen noch weitere zwei Starterwohnungen dazu“, ist
Bürgermeisterin Karin Baier stolz. Auch für ein entsprechendes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen
ist gesorgt. Ab September 2021 soll das Schulangebot um eine Volksschule, die
auch eine Ganztagesschulform anbietet, erweitert werden.
Die Stadtgemeinde Schwechat
fördert Projekte im Bereich der Jugend – „Der Jugendförderungsbeirat beurteilt
die eingereichten Projekte und gibt eine Empfehlung über die Höhe der zu
gewährenden Förderung an den Stadtrat weiter“, erklärt Baier, die darauf
hinweist, dass nicht nur viele Projekte für junge Menschen in Schwechat
umgesetzt werden, sondern auch für SeniorInnen: So gibt es einen
Seniorenausweis der Stadtgemeinde, Ausflüge, Urlaubsaktionen, einen kostenlosen
Rollstuhlverleih und natürlich auch einen Seniorenbeirat, der ähnlich
funktioniert, wie der Jugendbeirat. Dazu gibt es viele Freizeit- und
Kulturangebote, die die Lebensqualität der SchwechaterInnen erhöhen. „Schwechat
ist eine lebendige Stadt, eine Stadt, die sowohl für jüngere, als auch für
ältere Menschen Angebote hat. Die Angebote sind abwechslungsreich, da ist für
jeden etwas dabei. Leben und Lebensqualität gehen bei uns Hand in Hand“, freut
sich Baier.
Sie weist darauf hin, dass die
Stadtgemeinde auch Ausbildungsplätze für Lehrlinge anbietet: „Derzeit
beschäftigen wir sieben Lehrlinge – im Verwaltungsbereich, in der Gärtnerei und
am Bauhof. Unsere Lehrlinge leisten nicht nur fachlich Großartiges, es werden
auch die Persönlichkeit der Jugendlichen, ihre Teamfähigkeit und
Sozialkompetenzen entwickelt. Ich bin stolz auf die Leistungen unserer jungen
Menschen“, sagt Baier und ergänzt, dass auch die Schaffung zusätzlicher
Lehrstellen von Betrieben im Gemeindegebiet von der Stadtgemeinde gefördert
wird. Sie weist darauf hin, dass Schwechat auch im Rahmen der Aktion 20.000,
einer Maßnahme für langzeitarbeitslose Menschen über 50 Jahre, Jobs angeboten
bzw. geschaffen hat. „Bedingt durch die
unverständlicherweise im letzten Moment abgedrehte Aktion 20.000 konnten wir
statt der geplanten 55 Arbeitsplätze für arbeitslose Menschen über 50 Jahre nur
jene 20 aufnehmen, welche VOR dem Aussetzen der Aktion bereits namentlich
genannt und verständigt waren“, erklärt Baier: „Wir waren mit den Leistungen
größtenteils äußerst zufrieden, durch ein sehr geschicktes Personalmanagement
ist es uns gelungen, sieben dieser Personen nach Auslaufen ihres befristeten
Vertrages fixe Dienstposten anbieten zu können.“
Krems „zukunftsfähigste“ Stadt
Das ist das Ergebnis des aktuellen Zukunftsrankings, bei dem alle
94 Bezirke Österreichs und Statutarstädte unter die Lupe genommen wurden. Laut
Studie erzielt Krems über alle definierten Themenbereiche (Demografie,
Arbeitsmarkt, Wirtschaft & Innovation, Lebensqualität, Ärzteangebot usw.)
das beste Resultat. Über die Top-Noten freut sich Bürgermeister Dr. Reinhard
Resch: „Das neuerliche Top-Ergebnis ist eine Bestätigung, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.“ Ausschlaggebend seien die Schwerpunktsetzungen in den
Bereichen Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft, aber auch die
stadtentwicklerischen Zukunftsprojekte. „Die Anerkennung gebührt allen, die
sich für die Weiterentwicklung der Stadt einsetzen“, unterstreicht Resch.
Krems hat sich auch als Bildungsstadt in Niederösterreich
etabliert. So gibt es insgesamt 15.121 Studierende im Bildungscampus mit
Donau-Universität, Fachhochschule, Danube Private University, Kirchlicher
Pädagogischer Hochschule und der Karl Landsteiner Privatuniversität. Die
Studierendenzahlen, die 2015 noch bei 12.839 lagen, entwickeln sich
kontinuierlich weiter.
Wichtig ist der Stadt auch die Lehrlingsausbildung: „Wir bilden
seit Jahren regelmäßig Lehrlinge aus, derzeit werden sechs Lehrlinge in der
Hoheitsverwaltung, ein Lehrling als Bautechnischer Zeichner und drei Lehrlinge
in der Dienstleistungssparte ausgebildet“, weiß Resch. Die Stadt Krems hat
zudem sechs Personen im Rahmen der Aktion 20.000 aufgenommen, bis diese von Schwarz-Blau
eingestellt wurde und davon vier MitarbeiterInnen fix übernommen.
„Ein Budget mit Perspektive“
„Zukunftsfähig“ zeigt sich Krems auch beim fortgesetzten Konsolidierungskurs in
der Budgetpolitik – wie in den vergangenen Jahren wird ein ausgeglichenes
Budget angepeilt. Um die Kremser BürgerInnen nicht weiter zu belasten, gibt es
wie 2018 auch 2019 keine Gebührenerhöhungen. Der Schuldenstand der Stadt Krems
sinkt weiterhin.
Beispielsweise soll der Startschuss für das künftige Feuerwehrhaus
Krems-Süd noch heuer fallen. Die
Eröffnung ist für 2021 geplant. Ebenso ist 2020 die Fertigstellung der neuen
Zentrale des Roten Kreuzes am Mitterweg eingeplant, bei der die Stadt Krems
mitfinanziert. Mit 2019 ist auch der Beginn für die Detailplanung und Ausschreibung
zur Erhöhung des Hochwasserschutzes für Krems-Stein vorgesehen. Budgetmittel
für die anteiligen Kosten sind berücksichtigt. Ebenso steht 2019 auch die
Generalsanierung der Volksschule Hafnerplatz und 2020 der Bau eines
viergruppigen Kindergartens in der Mitterau an. Für neues Equipment der
Feuerwehr stehen im kommenden Jahr ebenfalls Mittel in Höhe von 450.000 Euro
zur Verfügung. Ein großes Projekt wird in den kommenden Jahren die Sport- und
Freizeitmeile sein mit Erneuerung der Badearena und Sanierung der Sporthalle.
„Das Budget 2019 ist in
einem gemeinsamen Prozess aller Fraktionen und Bereichsleiter zustande
gekommen“, betont Bürgermeister Dr. Reinhard Resch. „Wir haben ein Budget
erstellt, das dank eines professionellen Controllings umsetzbar ist, mit dem
wir lange fällige Investitionen auf den Weg bringen, die Gebühren nicht erhöhen
und auch noch den Schuldenstand reduzieren“, so Resch: „Der Vier-Jahres-Plan,
in dem das Budget 2019 eingebettet ist, stellt ein Novum dar. Es ist ein sehr
ehrgeiziger Plan, aber mit viel Sparwillen und verträglichen Einsparungen in
der Hoheitsverwaltung umsetzbar.“
Entwickeln „Unser Amstetten“ erfolgreich weiter
„Infrastruktur zukunftsorientiert und am Bedarf einer modernen Gesellschaft zu
gestalten und nicht bloß zu verwalten, ist seit vielen Jahren vordringliches
Ziel der Stadt Amstetten. Gemeinsam mit den BürgerInnen entwickeln wir ‚unser
Amstetten‘ erfolgreich weiter“, erklärt die Amstettner Bürgermeisterin Ursula
Puchebner.
Die Modernisierung der
Kinderbetreuungseinrichtungen, um Eltern eine gute Basis zu Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu bieten, die Schaffung eines Bildungscampus mit dem Bau der
Neuen Mittelschule, der Angliederung der Regionalmusikschule und neue
Räumlichkeiten für den Musikverein, im tertiären Bildungsbereit die
Zukunftsakademie Mostviertel und ein breites Angebot in der Volkshochschule
sind nur einige Beispiele für die Weiterentwicklung Amstettens im
Bildungsbereich. „Aktuell
beschäftigen wir uns mit der Erarbeitung von Strategien und dem Ausloten von
Möglichkeiten, dass Amstetten Standort eines dislozierten
Fachhochschullehrganges werden kann. Ziel ist es, junge Menschen in Amstetten zu
halten bzw. junge Menschen nach Amstetten bringen“, erklärt Bürgermeisterin
Ursula Puchebner. Zu den Angeboten im Bildungsbereich kommt, dass sich
Amstetten in den Jahren auch einen besonderen Stellenwert in NÖ als
Musicalstadt erworben hat und ein umfassendes Angebot an Sport- und
Freizeiteinrichtungen verfügt – derzeit wird etwa die Generalsanierung des
Allwetterbades geplant und ein Motorik- und Bewegungspark ist im Entstehen.
Mobilität als Zukunftsthema
„Mobilität ist ein ganz zentrales Thema, dem wir uns ganz
besonders intensiv widmen. Amstetten liegt verkehrsmäßig äußerst günstig.
Angebunden an die A1 sowie an die Schiene sind wir damit konfrontiert, dass
viele Menschen nach Amstetten einpendeln, um zu ihren Arbeitsplätzen zu
gelangen. Ebenso viele nützen die weiterführenden Angebote der Bahn, um weiter
zu reisen. Das stellt uns vor die große Herausforderung zum Einen den Individualverkehr möglichst gering zu halten
und andererseits Parkmöglichkeiten in entsprechender Anzahl anbieten zu
können, die von den ZugnutzerInnen in Bahnhofsnähe kostengünstig in Anspruch
genommen werden können“, erklärt Puchebner: „Gemeindeübergreifende Mobilitätskonzepte sind daher gefragt und
werden derzeit intensivst diskutiert. Als Bezirkshauptstadt stehen wir hier im
Spannungsfeld ständig – auch in anderen Lebensbereichen – zusätzliche
Infrastruktur schaffen zu müssen, damit verbunden ist aber auch ein
entsprechend hoher Kostenfaktor, der sich derzeit ausschließlich im Haushalt
der Stadt niederschlägt.“
Amstetten betreibt einen CityBus sowie ein
Anrufsammeltaxi-System, das auch die Ortsteile Mauer-Greinsfurth sowie
Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth bedient. Die Kosten in diesem Bereich betragen
jährlich rund 750.000 Euro. „Eine Ausweitung des CityBus-Betriebes auf die Umlandgemeinden
ist nur unter Kostenbeteiligung der Gemeinden der Region möglich, was derzeit
nahezu unmöglich scheint“, sagt Puchebner: „Neue Mobilitätsformen und –konzepte
stehen daher ganz in unserem Fokus auch im Hinblick auf die CO2-Reduzierung und
die weitere Steigerung der Lebensqualität.“
Im Sinne des Klimaschutzes ist Amstetten in den
verschiedensten Bereichen bereits in der Vergangenheit immer wieder Vorreiter
gewesen. Ein besonderes Projekt „Wärme aus Abwasser“ wurde umgesetzt und
Amstetten wurde auf europäischer Ebene zur „Europäischen Wärmepumpenhauptstadt“
ausgezeichnet. „Aktuell beschäftigt uns sehr intensiv die Vermeidung von
Verpackungsmaterialien aller Art. Ziel: Die Errichtung eines
‚Unverpackt-Ladens‘ in der Innenstadt von Amstetten“, blickt Puchebner in die
Zukunft.
Amstetten ist ein Standort für rund 1.200 Unternehmen,
darunter viele Leitbetriebe der Region, mit insgesamt 17.000 Arbeitsplätzen.
„Nur wo es Arbeitsplätze gibt, wollen die Menschen auch ihren Lebensmittelpunkt
haben – deswegen ist es mir ein Anliegen, für mögliche Erweiterungen
Grundstücksreserven bereit zu halten, um eine Absiedlung von Unternehmen zu
verhindern.“ Die Bürgermeisterin setzt im öffentlichen Bereich seit Jahren auf
ökologische Bauweise, die Ökonomie nicht ausschließt und ist bestrebt, eine
Vielfalt an Wohnmöglichkeiten zu bieten: „‘Junges Wohnen‘ ist brandaktuell. Die
Kontakte mit dem ortsansässigen Wohnbauträger sind hergestellt, ein Grundstück
gefunden. Die Umsetzung ist also in greifbarer Nähe.“
Abschließend weisen die vier BürgermeisterInnen – Matthias
Stadler, Karin Baier, Reinhard Resch und Ursula Puchebner auf das
Zehn-Punkte-Programm der SPÖ NÖ und das Programm der SPÖ hin – hier sind alle
Gesichtspunkte, mit denen Projekte in ihren Kommunen erstellt werden,
enthalten. „Es ist wichtig, dass die Kommunen mit Förderungen bei ihren
Vorhaben, die Lebensqualität und das Angebot zu verbessern, unterstützt werden.
Künftigen, notwendigen Investitionsoffensiven sollte große Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Sei es beim notwendigen Ausbau der sozialen und
gesundheitspolitischen Infrastruktur, wie beispielsweise Jungem Wohnen,
betreuten Wohnen oder der Sicherung der ärztlichen Versorgung, sei es beim
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, bei Kulturprojekten oder der Unterstützung
von Betriebsansiedelungen. Die Kommunen sind bereit, Verantwortung zu
übernehmen, aber sowohl größere und ganz
besonders kleine Gemeinden brauchen hier bestmögliche Unterstützung von Bund
und Land“, fordert Stadler sowohl als Bürgermeister, als auch als
Bezirksparteivorsitzender ein.
- Sicherstellung der Nahversorgung mit wichtiger
Infrastruktur, wie Lebensmittelgeschäften, Postämtern, Bankomaten, Bahnkassen
und der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes.
- Sicherstellung der ärztlichen Versorgung mit
ausreichend praktischen Ärzten und flächendeckender ärztlicher Bereitschaft an
Feiertagen und Wochenenden.
- Wiedereinrichtung von zumindest 20, der durch die
ÖVP-InnenministerInnen allein in Niederösterreich geschlossenen
Polizeiinspektionen.
- Leistbarer Wohnraum – durch die Abschaffung der
Mehrwertsteuer auf Mieten und der Maklergebühren für MieterInnen sowie die
Einführung der Widmungskategorie „Sozialer Wohnbau“.
- Ausbau des Angebots verschränkter Ganztags-Schulen und
Gratis-Nachhilfe.
- In Sachen Klimaschutz: Förderung von
Gemeinde-Initiativen zur Plastikvermeidung. Weiters: Einführung eines
Pfandsystems und die Unterstützung des Klimavolksbegehrens.
- Eine optimale Pflegenahversorgung – durch die
Attraktivierung des Pflegeberufs, die Einführung der Pflegegarantie und den
Rechtsanspruch auf Pflegekarenz.
- Nachhaltige Entlastung der Familien. Z.B. dadurch,
dass Niederösterreichs Kindergärten endlich ganztags, ganzjährig und kostenfrei
zur Verfügung stehen (wie z. B. die Landesaktion im Burgenland).
- Die bereits präsentierten Forderungen im Bereich der
Arbeitswelt, wie etwa das Recht auf die 4-Tage-Woche.
- Kostengünstiger, wohnortnaher, gut getakteter
öffentlicher Verkehr, 365-Euro-Öffi-Jahresticket.