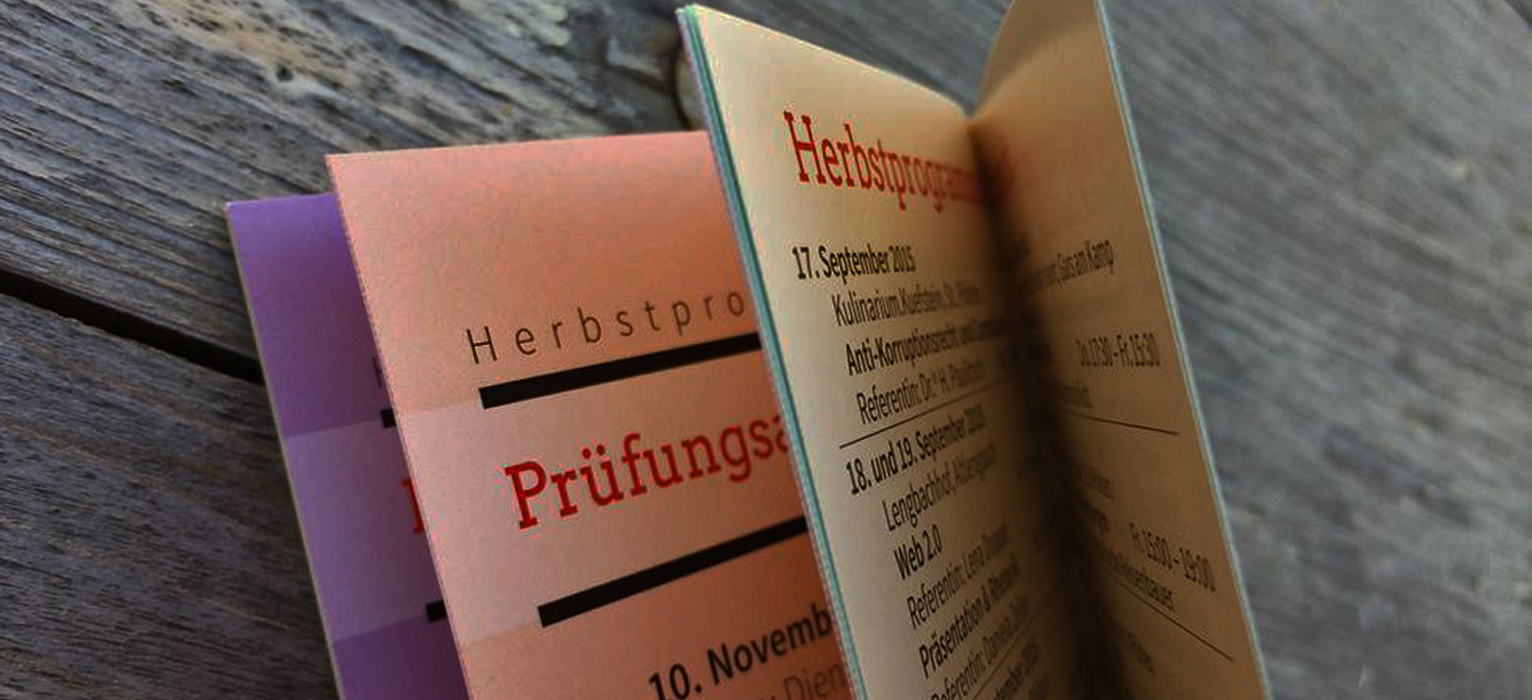Investitionen und Ausgaben der Gemeinden gestiegen und Transferzahlungen belasten Budgets – Schwächeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren erwartet.
Der Gemeindefinanzbericht 2018 des Österreichischen Gemeindebundes zeigt steigende Einnahmen, einen Höchststand an Investitionsleistungen, aber auch steigende „Pflicht-Ausgaben” und ein leichtes Maastricht-Defizit. „Die Gemeinden ohne Wien haben 2018 verantwortungsvoll und mit Hausverstand in ihren Kommunen investiert. Die gute Konjunktur ließ auch die Einnahmen der Gemeinden steigen. Mit 2,745 Milliarden Euro Ausgaben für Investitionen sind wir weiterhin die wichtigsten regionalen Investoren. Aber, der steigende Ausgabendruck bei Kinderbetreuung, Pflegeheimen und den Transferzahlungen fordert uns immer mehr“, fasst Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl die finanzielle Situation der Gemeinden zusammen.
Der Leiter des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) Christoph Badelt ergänzt, dass von einer abgeschwächten Dynamik beim Einnahmenwachstum für alle Gebietskörperschaften auszugehen ist: „Dort, wo die Gemeinden unsere Zukunft gestalten, ist eine stabile Finanzierung aber von besonderer Bedeutung.“
Einnahmen und Investitionen gestiegen
Zu den Zahlen: Die österreichischen Gemeinden ohne Wien haben im letzten Jahr 22,591 Milliarden Euro eingenommen. Die größten Einnahmequellen: 6,67 Milliarden Euro an Ertragsanteilen (+6,4 % gegenüber dem Vorjahr), 2,457 Milliarden Euro an Kommunalsteuer (+5,8 %), 2,09 Milliarden Euro Gebühreneinnahmen (+3,8 %) und 603 Millionen Euro aus der Grundsteuer (+3,4 %). Im Jahr 2018 konnten die Investitionen der Gemeinden um 11,3 Prozent auf 2,745 Milliarden Euro gesteigert werden. Ein Grund dafür war unter anderem das Kommunale Investitionsprogramm mit rund 115 Millionen Euro zusätzlichen Mitteln für die Gemeinden. Bei der laufenden Gebarung zeigt sich ein positiver Saldo von 2,114 Milliarden Euro.
Steigende Ausgaben belasten Budgets
Seit Jahren steigen die „Pflicht-Ausgaben“ der Gemeinden. Seit 2012 sind etwa die Ausgaben für die Kinderbetreuung der Gemeinden um 41,6 Prozent auf 1,135 Milliarden Euro angestiegen. Bei den Ausgaben für Soziales (u.a. Mindestsicherung) und Pflege sind die Ausgaben seit 2012 um 30,7 Prozent auf 1,537 Milliarden Euro gestiegen. Für die Krankenanstalten müssen die Gemeinden mittlerweile rund 1 Milliarde Euro im Jahr mitfinanzieren. Auch bei den Transferzahlungen gibt es einen neuen Höchststand von 4,09 Milliarden Euro.
Bei der Schuldenentwicklung 2018 zeigt sich ein divergierendes Bild. Nachdem die Schulden seit 2012 gesunken sind, stiegen sie 2018 um 571 Millionen Euro an. Ein Großteil dieses Anstieges geht auf Kosten von Wiedereingliederungen v.a. der Grazer Immobiliengesellschaft ins Budget der Stadt. Alles in allem haben die Gemeinden mit ihren 11,6 Milliarden Euro Schulden „nur“ einen Anteil von 3,1 Prozent an den Gesamtschulden des Staates. Das günstige Zinsumfeld hat auch im letzten Jahr den Gemeinden viel Geld gespart. Statt 206 Millionen Euro (2017) mussten 2018 nur 146 Millionen Euro für die Zinszahlungen aufgewendet werden. Ein Blick auf das Maastricht-Ergebnis zeigt kein allzu rosiges Bild. Die Gemeinden waren im Jahr 2018 mit 12 Millionen Euro im Minus, während Bund und Länder ein Plus ablieferten.
Gemeinden sind wichtige regionale Wirtschaftsmotoren
WIFO-Leiter Christoph Badelt warf einen kurzen Blick auf die wirtschaftliche Gesamtsituation des Staates. „Wir befinden uns am Ende einer Hochkonjunkturphase und blicken auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren.“ Die wesentlichen Leistungen der Daseinsvorsorge auf Gemeindeebene sollten allerdings möglichst unabhängig von konjunkturellen Rahmenbedingungen finanziert werden. Dabei hob Badelt die Notwendigkeit für Zukunftsinvestitionen in Schlüsselbereichen wie der Pflege, der Kinderbetreuung und der Digitalisierung hervor: „Der Bedarf und die Notwendigkeit für zusätzliche Mittel in diesen Bereichen ist in zahlreichen Studien des WIFO hinreichend dokumentiert.“ Vor dem Hintergrund einer hohen Abgabenbelastung in Österreich bedürfe es jedoch gemeinsamer Anstrengungen von Bund, Ländern und Gemeinden, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen – etwa durch das Ausschöpfen von Effizienzreserven und einer neu zugestaltenden Aufteilung und Priorisierung von Aufgaben.
Finanzielle Zukunft der Gemeinden wird herausfordernd
„Der Finanzbericht zeigt deutlich, dass der Druck in den Gemeinden immer weiter steigt. Fast 80 Prozent der Einnahmen der Gemeinden sind jedes Jahr bereits verplant, bevor die Bürgermeister überhaupt Projekte andenken können. Jetzt ist es an der Zeit, Einnahmen zu stärken, Kosten zu dämpfen, Doppelgleisigkeiten zu verhindern und gemeinsame Zukunftsfragen zu lösen“, betont Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. Der Österreichische Gemeindebund hat den Parteien auch zum Start der Regierungsverhandlungen sein Forderungspapier übermittelt, in dem die Anliegen der Gemeinden enthalten sind. „Gerade, wenn es um die Finanzen geht, müssen wir uns auf die Beine stellen. Für die Gemeinden im ländlichen Raum gibt es sonst kaum Spielraum für Zukunftsinvestitionen“, so Riedl. Seine Forderungen unter anderem: Erhöhung des Gemeindeanteils an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben von derzeit 11,849 Prozent und eine Zweckbindung der Mehreinnahmen für den ländlichen Raum; Reform der Grundsteuer mit einem moderaten Mehraufkommen und zur Steuerung des Bodenverbrauchs (für ein durchschnittliches Einfamilienhaus liegt die Grundsteuer aktuell bei 8-12 Euro pro Monat); eine punktuelle 15a-Vertragsfähigkeit, damit die Gemeinden auch bei den Bereichen mitreden können, die sie finanzieren müssen; mehr Mittel für den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum, denn die FAG-Mittel gehen bisher fast zur Gänze in die Ballungszentren; Reformen im Schulbereich mit dem Ziel „Alles Personal in eine Hand“ und ein zentrales Haushaltsregister für mehr Transparenz und weniger Bürokratie.