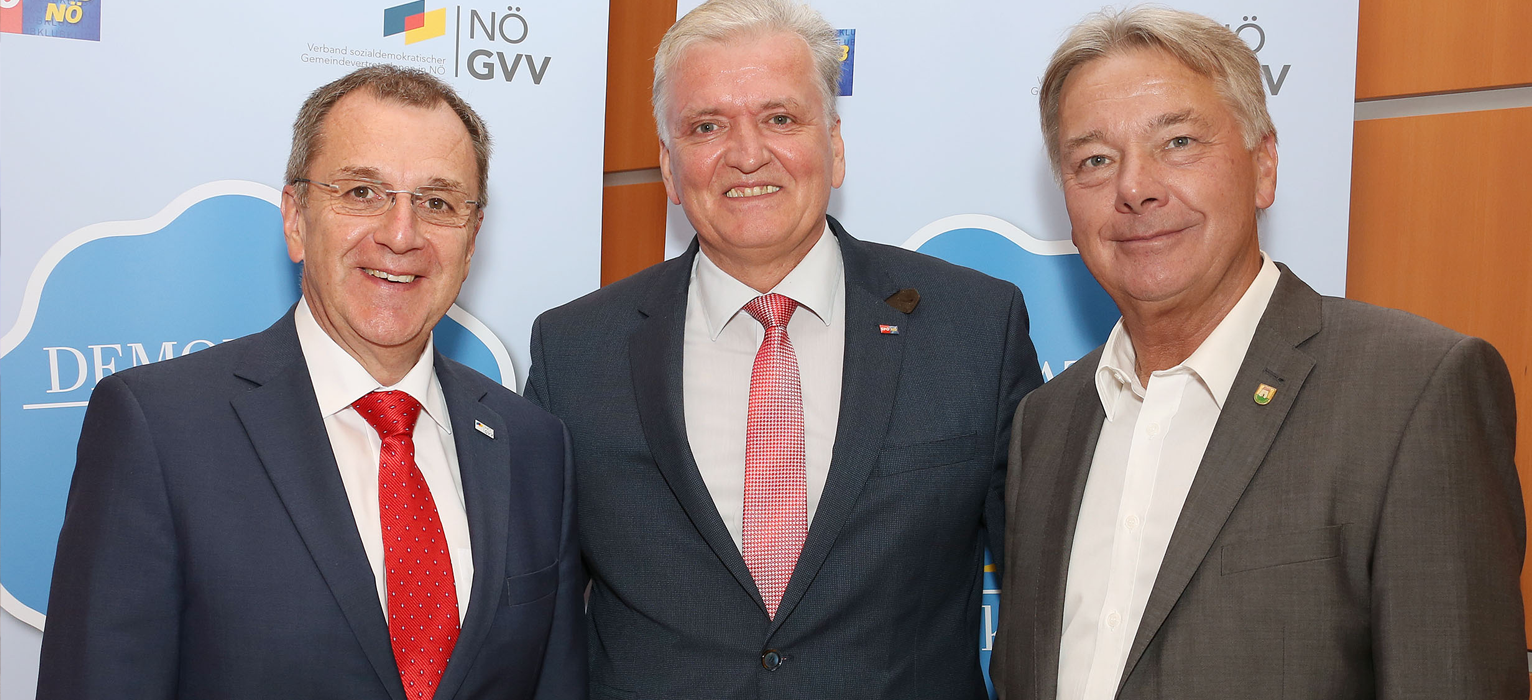SPÖ NÖ legt Zehn-Punkte-Programm für mehr Demokratie in NÖ vor.
„Die Zeit ist reif für ein offeneres, demokratischeres und lebenswerteres, soziales und gerechtes Niederösterreich! Es ist Zeit, ein Niederösterreich für die Menschen in diesem Land zu schaffen!“, ist für SPÖ NÖ Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl eine starke Aufbruchsstimmung in Niederösterreich erkennbar. In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Enquete zum Thema Wahlrechtsreform und Demokratiepaket sagt Schnabl, dass es für ihn zu einem „neuen Niederösterreich“ dazugehöre, „mehr Demokratie zu wagen“.
Entfall des Grundsatzes „Name vor Partei“
Im Vorfeld der kommenden NÖ Landtagswahl fordert Schnabl Vorkehrungen, die ausschließen, dass eine Person mehrfach in der Landeswählerevidenz aufscheint: „Es liegen uns Beispiele vor, dass Personen bei der Landtagswahl 2013 mehrmals ihre Stimme abgegeben haben – das ist undemokratisch und muss unterbunden werden!“ Um ein bundeseinheitliches Wahlermittlungsverfahren zu gewährleisten, fordert Schnabl den Entfall des Grundsatzes „Name vor Partei“ – damit soll bei Vergabe einer Vorzugsstimme für eine/n KandidatIn und gleichzeitiger Nennung einer Partei, die Stimme der Partei zugerechnet werden. Zudem fordert Schnabl die Möglichkeit einer Volksabstimmung auf Landesebene, eines Landesvolksbegehrens und der dringlichen Anfrage im Landtag sowie für die Wahl der beiden Landeshauptmann-StellvertreterInnen, die laut Verfassung den beiden mandatsstärksten Parteien zu entnehmen sind, die Klarstellung einer „gebundenen“ Wahl ohne Mehrheit des Landtages. In Niederösterreich seien, wie in keinem anderen Bundesland, Beschlüsse der Landesregierung geheim, sagt Schnabl, der die Offenlegung fordert: „In Deutschland wird wöchentlich ein Bericht über die Beschlüsse der Bundesregierung veröffentlicht, auch in Österreich sind die Ministerratsbeschlüsse nachzulesen – nur in Niederösterreich gibt es Geheimhaltung. Aber Transparenz ist die Basis für demokratische Mitsprachemöglichkeiten anderer Parteien und Bürgerinitiativen im politischen Prozess.“ Zudem soll es ein Rederecht für Bundesräte und Europaabgeordnete sowie für Rechnungshofpräsident des Bundes bzw. Rechnungshofdirektor und Volksanwälte im Landtag geben, die Nominierung des Landesrechnungshofdirektors als Minderheitenrecht und einen Ausschussvorsitzenden im Rechnungshof durch eine Minderheitsfraktion.
SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender schlägt Bürgermeister-Direktwahl vor
Auch auf Gemeindeebene fordert der SPÖ NÖ Vorsitzende Reformen: Grundsätzlich soll jeder Wahlberechtigte mit einem Wohnsitz in NÖ nur einmal wahlberechtigt sein, außerdem soll auch hier der Entfall des Grundsatzes „Name vor Partei“ gelten. Schnabl schlägt außerdem die Bürgermeister-Direktwahl vor: „Wir wollen hier dem Beispiel anderer Bundesländer folgen – unter gleichzeitiger Anpassung der NÖ Gemeindeordnung, damit Gemeinden, in denen Bürgermeister nicht der Mehrheitsfraktion angehören, regierbar bleiben und gleichzeitig Minderheitenrechte gestärkt werden.“ Zudem sollen der nichtamtliche Stimmzettel bei Gemeinderatswahlen entfallen und das passive Wahlrecht so eingeschränkt werden, dass die Annahme eines Mandats nur in einer Gemeinde möglich bzw. für die Wahl zum geschäftsführenden Gemeinderat bzw. Stadtrat oder Bürgermeister ein Hauptwohnsitz Voraussetzung ist. Weitere Reformpläne sind die Schaffung von Bürgerfragestunden, die Einberufung von Gemeindeversammlungen sowie die Schaffung des Instrumentes einer Volksabstimmung auf Gemeindeebene und von Beiräten für Schule, Kindergärten, Verkehr, Senioren und Katastralgemeinden.
Rechte der BürgerInnen stärken
„In Zeiten, wo die Wahlbeteiligungen sinken, ist für die Sozialdemokratie wichtig, dass wir das Vertrauen der WählerInnen und BürgerInnen in die Demokratie stärken. Deshalb bin ich sehr froh, dass Franz Schnabl mutig und entschlossen im Interesse der LandesbürgerInnen ein Demokratiepaket diskutieren möchte“, sagt der Präsident des sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes, LAbg. Bgm. Rupert Dworak: „Als NÖ GVV-Präsident ist mir dabei ganz wichtig, dass wir die Rechte der BürgerInnen stärken und jeden Missbrauch eindämmen. Das Wahlrecht für die Zweitwohnsitzer gehört ganz klar definiert, das Persönlichkeitswahlrecht am amtlichen Stimmzettel gestärkt. Mit der immer wieder stattgefundenen Beugung des Wahlrechts am nichtamtlichen Stimmzettel muss endlich Schluss sein. Und wenn man mit der Briefwahlkarte wählen geht, dann muss es künftig mindestens einen persönlichen Kontakt mit dem Gemeindeamt geben.“
Ziel der Landespolitik muss es sein, praktikable Gesetze zu beschließen, die für die BürgerInnen die größtmögliche Transparenz gewährleisten, sagt SPÖ NÖ Klubobmann Alfredo Rosenmaier: „Daher wollen wir ein Gesamtpaket, dass sich zusammensetzt aus ‚Ein Hauptwohnsitz – eine Stimme‘, ‚Ein/e WählerIn – eine Vorzugsstimme für einen Kandidaten‘, ‚Ein Politiker – ein GR-Mandat‘.“ Im Wählerregister dürfe es keine intransparenten Automatismen und keine schwammigen Kann-Bestimmungen mehr geben, erklärt der Landespolitiker: „Wir brauchen Klarheit für die WählerInnen, die Wahlkommissionen und Gemeinden, um Anfechtungen aufgrund offen gelassener Interpretationsspielräume keine Chance mehr zu geben.“
Die Chance, einen Demokratieschub für Niederösterreich herbeizuführen solle genutzt werden, sagt Rosenmaier: „Die ÖVP wäre gut beraten, mit allen Parteien gemeinsam Niederösterreich neu zu denken und weiter zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu finden. Beginnend mit einer transparenteren Gestaltung der Regierungsarbeit, dem Ausbau der Minderheitenrechte im NÖ Landtag, die Stärkung der Mitbestimmung durch die BürgerInnen bis hin zu einer grundlegenden Reformierung des geltenden Wahlrechts.“
Bild zum Download: